"Ich hoffe für uns alle das Beste – denn die Hoffnung stirbt zuletzt," schreibt Martina Bay. "Die Natur fragt nicht nach Feiertagen und hat uns einen Strich durch den Veranstaltungskalender gemacht. Seit dem 17. März zwingt uns ein Winzling, das Corona-Virus, in die Knie und verändert das Leben von uns Hammelburgern und von Millionen Menschen weltweit."
Samstag, der 9. Mai 2020. Gestern war der Gedenktag zum Ende des 2. Weltkriegs am 8. Mai 1945: 75 Jahre, in denen Europa weitgehend befriedet wurde und der größte Teil der europäischen Staaten sich zur friedlichen und freundschaftlichen Koexistenz entschlossen hat, sind seither vergangen. Auch der heutige Tag, der 9. Mai, ist ein bedeutungsvoller Gedenktag für uns Europäer: Vor 70 Jahren wurde mit der Gründung der Montanunion der Grundstein zur heutigen Europäischen Union gelegt, die in den vergangenen Jahrzehnten Garant war für den lange währenden Frieden. Es sollte ein Wochenende der großen Feiern werden, denkwürdige Tage, in denen die Welt und Europa mit Demut, aber auch mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken würden.
Aber die Natur fragt nicht nach Feiertagen und hat uns einen Strich durch den Veranstaltungskalender gemacht. Seit dem 17. März zwingt uns ein Winzling, das Corona-Virus, in die Knie und verändert das Leben von uns Hammelburgern und von Millionen Menschen weltweit.
Trauer
Um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern, wurden mit der Ankunft des Virus in Bayern massive Einschränkungen v.a. von sozialen Kontakten verfügt. Schulen, Kitas und Universitäten wurden geschlossen. Bewohner von Pflegeheimen und Kranke in den Kliniken durften nicht mehr besucht werden; Gottesdienste nur noch online, Beisetzungen ohne Trauergemeinde, Hochzeiten mit limitierter Gästezahl ohne Feier – eine sozial-emotionale Tragödie. Wissenschaftler und Politiker meldeten sich zu Wort – um uns zu erklären, was „Pandemie“, „exponentieller Anstieg“ und „Reproduktionsfaktor“ bedeuten, und um die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Verordnungen und allgemeine Regeln umzusetzen. Zunächst fanden die meisten Bürger das sinnvoll und hielten sich weitgehend an die Beschränkungen – in der Hoffnung, dass der ganze „Spuk“ in drei bis vier Wochen ausgestanden sein würde.
Während das Virus weltweit ungehindert seinen Siegeszug fortsetzte, wurde klar, dass nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung auf dem Spiel stand, sondern ganze Volkswirtschaften in höchstem Maße gefährdet waren und es bis heute sind.
Nachdenklich geworden stellten sich – nicht nur mir – viele Fragen:
Wie und v.a. wie lange halten wir diese Beschränkungen sozial, emotional und wirtschaftlich durch? Steuern einige Staaten auf eine neue Diktatur zur? Welchen langfristigen Schaden richten die ganzen kruden Verschwörungstheorien an, die von vielen, nicht nur extremen Seiten im digitalen Netz verbreitet werden? Was passiert mit den Flüchtlingen, die in den Lagern an den Grenzen zu Europa gestrandet sind? Wo bleibt der Umweltschutz, denn „Fridays for Future“ gehen im allgemeinen Chaos unter? Sind aufgrund der Bestimmungen unsere verbrieften Grundrechte auf Freiheit in Gefahr? Wer sind die asozialen und kriminellen Menschen, die mit dringend benötigten Hilfsmitteln horrende Gewinne machen oder finanzielle Hilfen in Anspruch nehmen, um damit ihr „schmutziges Geld“ zu waschen? Und – ganz banal – wann können wir wieder miteinander singen?
Diese Liste ließe sich beliebig fortführen, und ich erlebte, dass sich langsam Depression und Wut auch in mir breitmachten. Die ersten bemerkbaren Lockerungen und daraus resultierenden Demonstrationen führten zu einem erneuten Anstieg der Neuinfektionen. Haben wir aus den vergangenen Wochen nichts gelernt?
Ich hoffe für uns alle das Beste – denn die Hoffnung stirbt zuletzt.
Freude
„Wer weiß, wozu es gut ist!?“ Diesen Satz hörte ich oft von meiner Mutter – gerade in kritischen Situationen, und nun kommt er mir wieder verstärkt in den Sinn. Die Pandemie hat tatsächlich auch einiges an Erfreulichem für viele Menschen gebracht:
Man tauschte sich telefonisch, über E-Mail, „WhatsApp“ und andere soziale Medien aus. Sogar Briefe und Karten sollen wieder geschrieben worden sein. Die Solidarität der Menschen untereinander zeigte sich z.B. in Angeboten, einkaufen zu gehen, Mund-und Nasenschutzmasken zu nähen und zu verschenken. Eingeschlafene Freundschaften wurden wieder belebt.
Berufe, die vorher nicht besonders wertgeschätzt und v.a. teilweise schlecht bezahlt waren, wurden plötzlich „systemrelevant“: Alten- und Gesundheitspflegerinnen, Ärzte, Verkäuferinnen, Busfahrer, Müllwerker, Polizisten, Feuerwehrleute, Erzieherinnen u.v.m. standen plötzlich im Fokus allgemeiner Lobreden. Die Menschen klatschten ihnen als Zeichen der Wertschätzung täglich und öffentlich Beifall. Musiker*innen spielten aus Beethovens 9. Symphonie die „Ode an die Freude“, die Europahymne, als Zeichen der Verbundenheit mit den europäischen Staaten, die die Pandemie besonders hart getroffen hatte: Italien, Spanien und Frankreich.
Eine alleinerziehende Mutter erzählte, dass sie seit langem die beste, weil v.a. sehr viel Zeit mit ihren Kindern verbracht hat und selten eine solche Nähe gelebt hat. Die täglichen Mutmachertexte in der Tageszeitung und von unseren Pfarreimitgliedern im Internet waren wertvolle Quellen, aus denen wir schöpfen konnten.
Witzige Cartoons, Videos und Lieder zum Thema „Corona“ wurden zur Aufmunterung versendet, weitergeleitet und geliked, bis alle sie gesehen hatten.
Ich genoss den strahlend blauen Himmel ohne Kondensstreifen von Flugzeugen, die Stille in den ersten Wochen der Ausgangsbeschränkungen, die Wertschätzung vieler stiller Berufe, die Erkenntnis, dass wir mit weniger Konsum auch gut leben können ...
Ich weiß nicht, wie lange diese „verrückte“ Zeit noch andauern wird, ob wir erst am Anfang, am Höhepunkt oder am Ende des Ausnahmezustandes sind. Keiner kann sagen, was es letztendlich mit uns gemacht hat und was von der Mitmenschlichkeit übrigbleibt.
Aber eines weiß ich sicher: Ich freue mich darauf, die Menschen, die mir nahestehen, wieder in den Arm nehmen zu dürfen – ohne Angst, ihnen zu schaden; mit meinen Chören gemeinschaftlich zu proben und zu singen; Gottesdienste „hautnah“ und nicht im virtuellen Raum zu erleben und viele vergnügliche private und öffentliche Feste zu feiern.
Ich hoffe für uns alle das Beste – denn die Hoffnung stirbt zuletzt.
Martina Bay
*) Anmerkung des Webmasters
Titel und Tenor des Beitrags der freien Mitarbeiterin unseres Hammelburge Pfarrbriefs "miteinander" erinnern mich an ein Dokument des 2. Vatikanischen Konzils aus den 1960er-Jahren:
"Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände."
(Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute "Gaudium et spes", Nr. 1)
Markus Waite
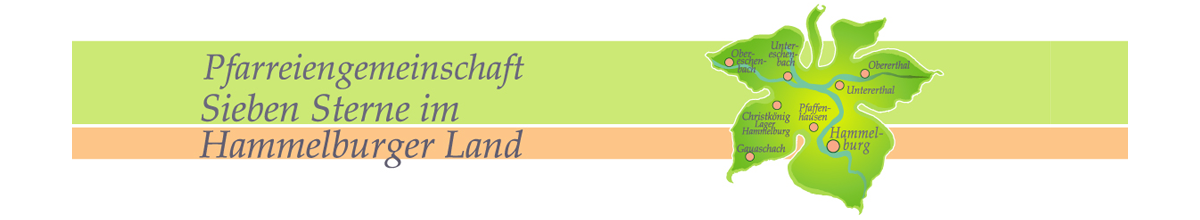
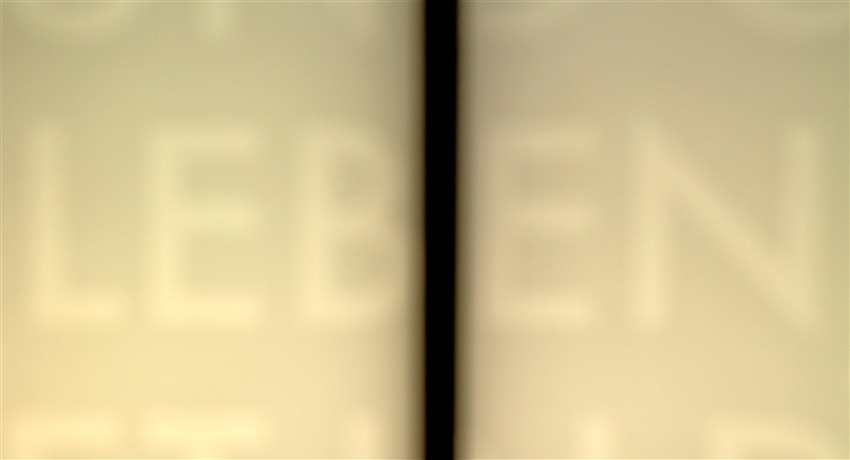 ###
###






